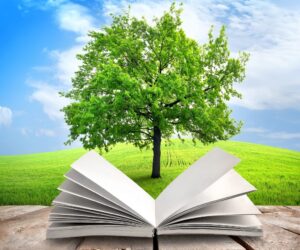Baumentfernung & Baumschutzgesetze in Deutschland: Ein umfassender Leitfaden
In Deutschland, wo Wälder und Bäume einen besonderen Platz im kulturellen Erbe und ökologischen Bewusstsein einnehmen, ist der Umgang mit Bäumen streng geregelt. Wenn du einen Baum auf deinem Grundstück entfernen möchtest oder wissen willst, welche Bäume unter Schutz stehen, ist es wichtig, die entsprechenden Gesetze und Verordnungen zu kennen. Dieser umfassende Leitfaden führt dich durch alle wichtigen Aspekte der Baumentfernung und Baumschutzgesetze in Deutschland, damit du rechtlich auf der sicheren Seite bist und zum Erhalt unserer wertvollen Baumbestände beiträgst.
Die rechtliche Grundlage des Baumschutzes in Deutschland
Das deutsche Baumschutzrecht basiert auf einem komplexen Zusammenspiel von Bundes- und Landesgesetzen sowie kommunalen Verordnungen. Die grundlegenden rechtlichen Rahmen bilden das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und die entsprechenden Naturschutzgesetze der Bundesländer. Zusätzlich haben viele Städte und Gemeinden eigene Baumschutzverordnungen erlassen, die oft strenger sind als die übergeordneten Gesetze.
Das Bundesnaturschutzgesetz als Basis
Das Bundesnaturschutzgesetz bildet die rechtliche Grundlage für den Naturschutz in ganz Deutschland. Es definiert allgemeine Schutzvorschriften für Pflanzen und Tiere, darunter auch Bäume. Besonders relevant ist § 39 BNatSchG, der das Fällen von Bäumen in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September grundsätzlich verbietet, um brütende Vögel zu schützen. Diese Periode wird oft als “Vegetationsperiode” oder “Schonzeit” bezeichnet.
Diese Regelung gilt für:
- Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze
- Röhrichte
- Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen
Es gibt jedoch Ausnahmen:
- Behördlich angeordnete oder zugelassene Maßnahmen
- Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden können
- Pflegemaßnahmen, die zur Erhaltung oder Entwicklung von Biotopen notwendig sind
- Schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen
Landesgesetze und ihre Bedeutung
Jedes Bundesland hat eigene Naturschutzgesetze, die die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes ergänzen und konkretisieren. Diese können sich erheblich voneinander unterscheiden. Hier einige Beispiele:
- In Bayern regelt das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) den Baumschutz. Hier gibt es keine landesweite Baumschutzverordnung, sondern die Gemeinden können eigene Verordnungen erlassen.
- In Baden-Württemberg enthält das Naturschutzgesetz ebenfalls Bestimmungen zum Baumschutz, überlässt aber die detaillierte Regelung ebenfalls den Kommunen.
- In Berlin gilt die Berliner Baumschutzverordnung, die besonders streng ist und nahezu alle Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 cm (gemessen in 1,3 m Höhe) schützt.
- In Nordrhein-Westfalen ermöglicht das Landschaftsgesetz den Gemeinden, eigene Baumschutzsatzungen zu erlassen.

Kommunale Baumschutzsatzungen – das Herzstück des deutschen Baumschutzes
Die konkretesten und oft strengsten Regelungen finden sich in den kommunalen Baumschutzsatzungen oder -verordnungen. Diese können von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich sein, weshalb es wichtig ist, die lokalen Bestimmungen zu kennen. Typischerweise regeln diese Satzungen:
- Welche Bäume geschützt sind (meist definiert durch Stammumfang oder -durchmesser)
- Welche Ausnahmen es gibt (z.B. für bestimmte Obstbaumsorten)
- Unter welchen Bedingungen eine Fällgenehmigung erteilt werden kann
- Welche Ersatzpflanzungen oder Ausgleichszahlungen bei einer Fällung erforderlich sind
- Welche Bußgelder bei Verstößen drohen
Die Stadt München beispielsweise schützt alle Laubbäume, Waldkiefern und Eiben mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm (gemessen in einer Höhe von 1 m über dem Boden). In Hamburg sind Bäume ab einem Stammumfang von 25 cm geschützt, in Berlin ab 80 cm. In einigen Gemeinden gibt es gar keine Baumschutzsatzung, in anderen wiederum sind die Regeln sehr streng.
Schutz durch weitere Gesetze und Verordnungen
Neben den genannten Gesetzen können Bäume auch durch andere rechtliche Bestimmungen geschützt sein:
- Denkmalschutzgesetz: Historische Bäume oder Bäume, die Teil einer denkmalgeschützten Anlage sind
- Landschaftsschutzverordnungen: Bäume in Landschaftsschutzgebieten
- Biotopschutz nach § 30 BNatSchG: Bestimmte naturnahe Biotope wie Auwälder oder Bruch- und Sumpfwälder
- Artenschutzrecht: Wenn geschützte Arten (wie bestimmte Fledermäuse oder Käfer) im Baum leben
- Nachbarschaftsrecht: Regelungen zu Grenzabständen und Überhang
Welche Bäume stehen unter Schutz?
Die Frage, welche Bäume unter Schutz stehen, ist nicht pauschal zu beantworten, da dies – wie bereits erwähnt – stark von den lokalen Baumschutzsatzungen abhängt. Dennoch gibt es einige allgemeine Kriterien, die häufig zur Anwendung kommen.
Kriterien für geschützte Bäume
Die meisten Baumschutzsatzungen definieren geschützte Bäume anhand folgender Kriterien:
1. Stammumfang oder -durchmesser: Die häufigste Methode, um festzulegen, welche Bäume geschützt sind, ist der Stammumfang oder -durchmesser. In vielen Gemeinden liegt die Grenze bei:
- 80 cm Stammumfang (ca. 25 cm Durchmesser) für Laubbäume
- 100 cm Stammumfang (ca. 30 cm Durchmesser) für Nadelbäume
Die Messung erfolgt in der Regel in einer Höhe von 1 m oder 1,3 m über dem Boden.
2. Baumart: Einige Satzungen unterscheiden nach Baumarten. Häufig sind Obstbäume (außer Walnuss und Esskastanie) von der Schutzverordnung ausgenommen, während seltene einheimische Arten besonderen Schutz genießen.
3. Standort: Der Standort des Baumes spielt ebenfalls eine Rolle. Oft gelten unterschiedliche Regelungen für:
- Bäume auf öffentlichem Grund
- Bäume auf privaten Grundstücken
- Bäume in Kleingärten
- Bäume in Baumschulen oder gewerblichen Obstplantagen
4. Besondere Bedeutung: Manche Bäume stehen aufgrund ihrer besonderen Bedeutung unter Schutz:
- Naturdenkmäler
- Habitatbäume (Bäume mit besonderer ökologischer Funktion)
- Bäume mit kulturhistorischer Bedeutung
- Bäume als Teil von geschützten Alleen

Übersicht geschützter Bäume in ausgewählten deutschen Städten
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Schutzkriterien in einigen größeren deutschen Städten:
| Stadt | Geschützte Bäume | Messhöhe | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Berlin | Alle Laub- und Nadelbäume ab 80 cm Stammumfang | 1,3 m | Auch mehrstämmige Bäume geschützt, wenn die Summe der Stammumfänge mind. 80 cm beträgt |
| Hamburg | Alle Laub- und Nadelbäume ab 25 cm Stammumfang | 1,3 m | Besonders strenger Schutz, auch für Ersatzpflanzungen |
| München | Laubbäume, Waldkiefern und Eiben ab 80 cm Stammumfang | 1 m | Keine Genehmigung für Fällungen zwischen 1. März und 30. September |
| Köln | Laubbäume ab 80 cm, Nadelbäume ab 100 cm Stammumfang | 1 m | Obstbäume auf Hausgrundstücken ausgenommen |
| Frankfurt | Laubbäume und Waldkiefern ab 60 cm Stammumfang | 1 m | Strenger Schutz auch für Ersatzpflanzungen |
| Dresden | Laubbäume ab 30 cm, Nadelbäume ab 40 cm Durchmesser | 1,3 m | Walnuss und Esskastanie geschützt, andere Obstbäume nicht |
| Leipzig | Bäume ab 15 cm Stammdurchmesser | 1 m | Auch Hecken ab 2 m Höhe geschützt |
Ausnahmen vom Baumschutz
Die meisten Baumschutzsatzungen sehen bestimmte Ausnahmen vor:
1. Bestimmte Baumarten:
- Obstbäume (mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie)
- Nadelbäume in Hausgärten (nicht in allen Gemeinden)
- Bäume in Baumschulen und Gärtnereien zu gewerblichen Zwecken
2. Bäume unter bestimmter Größe:
- Je nach Gemeinde alle Bäume unter dem definierten Stammumfang
- Jungbäume, die noch nicht die Schutzkriterien erfüllen
3. Bäume an bestimmten Standorten:
- Bäume auf Deichen und Dämmen
- Bäume in Kleingärten (teilweise)
- Bäume in forstwirtschaftlich genutzten Flächen (diese unterliegen dem Waldgesetz)
4. Besondere Situationen:
- Akute Gefahrensituationen (Gefahr im Verzug)
- Behördlich angeordnete Fällungen (z.B. aus Verkehrssicherungsgründen)
- Bäume, die im Rahmen genehmigter Bauvorhaben entfernt werden müssen
Es ist wichtig zu betonen, dass selbst bei diesen Ausnahmen oft Meldepflichten bestehen oder Ersatzpflanzungen vorgeschrieben sind. Zudem gilt auch für nicht geschützte Bäume die allgemeine Schonzeit während der Brutperiode vom 1. März bis 30. September.
Der Prozess der Baumentfernung: Was du wissen musst
Wenn du einen geschützten Baum entfernen möchtest, musst du einen bestimmten Prozess einhalten. Hier erfährst du, wie dieser Prozess typischerweise abläuft, welche Unterlagen du benötigst und welche Kosten auf dich zukommen können.
Antrag auf Fällgenehmigung
Der erste Schritt ist das Stellen eines Antrags auf Fällgenehmigung. Dieser wird in der Regel beim zuständigen Grünflächenamt, Umweltamt oder Ordnungsamt der Gemeinde eingereicht. In einigen Städten ist dies auch online möglich.
Erforderliche Unterlagen:
- Ausgefülltes Antragsformular (erhältlich bei der zuständigen Behörde oder online)
- Lageplan oder Skizze mit Standort des zu fällenden Baumes
- Fotos des Baumes
- Angaben zu Art, Stammumfang und Zustand des Baumes
- Begründung für die Fällung
- Ggf. Gutachten (z.B. bei Krankheit des Baumes)
- Bei Bauvorhaben: Baugenehmigung und Freiflächengestaltungsplan
- Ggf. Einverständniserklärung des Grundstückseigentümers (wenn du nicht selbst Eigentümer bist)
Gründe, die eine Fällgenehmigung rechtfertigen können:
- Der Baum ist krank, abgestorben oder nicht mehr standsicher
- Der Baum verursacht erhebliche Schäden an Gebäuden oder Infrastruktur
- Der Baum behindert ein genehmigtes Bauvorhaben und kann nicht erhalten werden
- Der Baum beeinträchtigt das Wachstum wertvoller Nachbarbäume erheblich
- Zwingende Gründe des Allgemeinwohls
Es ist wichtig zu wissen, dass folgende Gründe in der Regel NICHT ausreichen:
- Laubfall oder Nadeln im Garten oder auf der Terrasse
- Schattenwurf (außer bei extremer Beeinträchtigung der Wohnqualität)
- Normale Wurzelbildung ohne Schäden
- Allergien gegen Pollen (außer in medizinisch nachgewiesenen schweren Fällen)
- Persönliche Vorlieben bei der Gartengestaltung
Prüfung durch die Behörde
Nach Eingang deines Antrags wird dieser von der zuständigen Behörde geprüft. Häufig findet ein Ortstermin statt, bei dem ein Mitarbeiter des Amtes den Baum begutachtet. Die Bearbeitungszeit kann je nach Kommune zwischen wenigen Tagen und mehreren Monaten liegen.
Bei der Prüfung werden folgende Aspekte berücksichtigt:
- Zustand und Vitalität des Baumes
- Ökologischer Wert des Baumes
- Ortsbildprägende Funktion
- Gründe für die gewünschte Fällung
- Möglichkeit von Ersatzpflanzungen oder Ausgleichszahlungen
Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen
Wenn eine Fällgenehmigung erteilt wird, ist diese fast immer mit Auflagen verbunden. Die häufigste Auflage ist die Verpflichtung zu Ersatzpflanzungen. Als Faustregel gilt oft: Pro gefälltem Baum muss mindestens ein neuer Baum gepflanzt werden. Bei besonders wertvollen oder alten Bäumen können auch mehrere Ersatzpflanzungen vorgeschrieben werden.
Typische Regelungen für Ersatzpflanzungen:
- Die Ersatzpflanzung muss innerhalb einer bestimmten Frist erfolgen (oft im nächsten Pflanzjahr)
- Es werden bestimmte Mindestgrößen für die Ersatzbäume vorgeschrieben (häufig Stammumfang 14-16 cm)
- Es können bestimmte Baumarten vorgeschrieben werden (meist einheimische Arten)
- Die Anwachspflege muss für einen bestimmten Zeitraum (oft 2-3 Jahre) gewährleistet sein
Wenn Ersatzpflanzungen auf dem eigenen Grundstück nicht möglich sind (z.B. aus Platzmangel), gibt es Alternativen:
- Pflanzung auf einem anderen Grundstück des Antragstellers
- Pflanzung auf einem öffentlichen Grundstück
- Ausgleichszahlung an die Gemeinde
Die Höhe der Ausgleichszahlung orientiert sich in der Regel an den Kosten, die für eine Ersatzpflanzung inklusive mehrjähriger Pflege anfallen würden. Dies kann je nach Baumart und Region zwischen 500 und 1.500 Euro pro Baum betragen.
Kosten im Zusammenhang mit Baumentfernungen
Bei einer Baumentfernung können verschiedene Kosten anfallen:
1. Verwaltungsgebühren:
- Antragsgebühr: je nach Kommune zwischen 25 und 150 Euro
- Gebühr für Ortstermine: 50 bis 100 Euro
- Gebühr für die Genehmigung: 50 bis 300 Euro, abhängig vom Aufwand
2. Kosten für die Fällung:
- Fällung durch Fachfirma: 300 bis 2.000 Euro, abhängig von Größe und Lage des Baumes
- Stubben entfernen: 100 bis 500 Euro zusätzlich
- Entsorgungskosten: 50 bis 200 Euro
3. Kosten für Ersatzpflanzungen:
- Kauf eines Ersatzbaumes: 100 bis 500 Euro, je nach Größe und Art
- Pflanzkosten: 50 bis 200 Euro
- Pflegekosten für 2-3 Jahre: 100 bis 300 Euro
4. Ausgleichszahlungen:
- Zwischen 500 und 1.500 Euro pro Baum, je nach Kommune und Baumart
5. Zusätzliche Kosten:
- Baumgutachten (falls erforderlich): 200 bis 800 Euro
- Statik-Gutachten (bei Schäden an Gebäuden): 300 bis 1.000 Euro
Die Gesamtkosten für die Entfernung eines mittelgroßen Baumes inklusive Genehmigung und Ersatzpflanzung können somit zwischen 1.000 und 3.000 Euro liegen. Bei besonders großen oder schwer zugänglichen Bäumen können die Kosten deutlich höher sein.
Fristen und zeitliche Planung
Bei der Planung einer Baumentfernung solltest du die folgenden zeitlichen Aspekte beachten:
1. Schonzeit: Die wichtigste zeitliche Einschränkung ist die bereits erwähnte Schonzeit vom 1. März bis 30. September. In dieser Zeit dürfen grundsätzlich keine Bäume gefällt werden, es sei denn, es liegt eine spezielle Ausnahmegenehmigung vor oder es besteht akute Gefahr.
2. Bearbeitungszeit: Die Bearbeitung eines Fällantrags kann je nach Kommune zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten dauern. Es empfiehlt sich, den Antrag mindestens 2-3 Monate vor der geplanten Fällung zu stellen.
3. Einspruchsfristen: Nach Erteilung einer Fällgenehmigung gibt es in einigen Gemeinden Einspruchsfristen für Nachbarn oder Umweltverbände. Diese betragen in der Regel 1-4 Wochen.
4. Gültigkeitsdauer der Genehmigung: Eine erteilte Fällgenehmigung ist meist für einen begrenzten Zeitraum gültig, typischerweise für 1-2 Jahre. Wenn die Fällung in diesem Zeitraum nicht durchgeführt wird, muss ein neuer Antrag gestellt werden.
5. Fristen für Ersatzpflanzungen: Für vorgeschriebene Ersatzpflanzungen werden ebenfalls Fristen gesetzt, meist bis zum Ende der nächsten Pflanzperiode (Oktober bis April).
Optimale Zeitplanung:
- Juni-August: Antrag auf Fällgenehmigung stellen
- Oktober-November: Genehmigung erhalten
- November-Februar: Fällung durchführen
- Oktober-April: Ersatzpflanzung vornehmen

Konsequenzen bei Verstößen gegen Baumschutzbestimmungen
Der Verstoß gegen Baumschutzbestimmungen ist keine Bagatelle und kann ernsthafte rechtliche und finanzielle Konsequenzen haben. Hier erfährst du, welche Folgen drohen können.
Bußgelder und Strafen
Die Höhe der Bußgelder für illegale Baumfällungen variiert je nach Bundesland und Kommune, kann aber beträchtlich sein:
| Bundesland | Bußgeldrahmen | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Bayern | bis zu 50.000 € | Abhängig von lokalen Verordnungen |
| Berlin | bis zu 50.000 € | Besonders strenge Durchsetzung |
| Hamburg | bis zu 50.000 € | Staffelung nach Schwere des Verstoßes |
| Nordrhein-Westfalen | bis zu 50.000 € | Zusätzlich mögliche zivilrechtliche Ansprüche |
| Niedersachsen | bis zu 25.000 € | Kommunale Satzungen können abweichen |
| Sachsen | bis zu 50.000 € | Strafrechtliche Verfolgung in schweren Fällen möglich |
| Baden-Württemberg | bis zu 50.000 € | Zusätzliche Wertersatzzahlungen möglich |
Die konkrete Höhe des Bußgeldes richtet sich nach verschiedenen Faktoren:
- Art und Wert des gefällten Baumes
- Vorsatz oder Fahrlässigkeit
- Wirtschaftlicher Vorteil durch die Fällung
- Wiederholungstat
- Kooperation mit den Behörden nach der Tat
Bei besonders schwerwiegenden Fällen, etwa wenn geschützte Arten betroffen sind oder die Fällung im Zusammenhang mit einer Straftat steht (z.B. Betrug bei Bauvorhaben), kann auch eine strafrechtliche Verfolgung drohen.
Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen
Neben den Bußgeldern werden bei illegalen Fällungen fast immer Ersatzpflanzungen oder Ausgleichszahlungen angeordnet. Diese können deutlich strenger ausfallen als bei genehmigten Fällungen:
- Mehrfache Ersatzpflanzungen pro gefälltem Baum (3-5 Bäume sind nicht ungewöhnlich)
- Vorschrift größerer Ersatzbäume (z.B. Stammumfang 18-20 cm statt 14-16 cm)
- Höhere Ausgleichszahlungen (oft 150-200% des Normalwertes)
- Längere Pflegeverpflichtungen (5 Jahre statt der üblichen 2-3 Jahre)
Die Kosten für diese Maßnahmen können schnell in die Tausende Euro gehen und übertreffen oft die Bußgelder.
Wiederherstellungsanordnungen
In manchen Fällen können die Behörden Wiederherstellungsanordnungen erlassen. Dies bedeutet, dass der Zustand vor der illegalen Fällung so weit wie möglich wiederhergestellt werden muss.
Dies kann umfassen:
- Pflanzung größerer Ersatzbäume an genau derselben Stelle
- Wiederherstellung des umgebenden Biotops
- Regelmäßige Kontrollen und Berichte über das Anwachsen der Ersatzpflanzungen
- Langfristige Pflegeverpflichtungen (5-10 Jahre)
Auswirkungen auf Bauvorhaben
Besonders schwerwiegend können die Konsequenzen sein, wenn Bäume im Zusammenhang mit Bauvorhaben illegal entfernt werden:
- Baustopps und Verzögerungen bei der Baugenehmigung
- Änderung der Bauplanungen, um Ersatzpflanzungen zu ermöglichen
- Höhere Auflagen für den Baumschutz während der Bauphase
- In extremen Fällen: Rückbau bereits errichteter Gebäudeteile
Es gibt Fälle, in denen Bauherren nach illegalen Fällungen die Baugenehmigung komplett verweigert wurde oder erhebliche Umplanungen nötig waren, die zu Mehrkosten im sechsstelligen Bereich führten.

Fallbeispiele aus der Rechtsprechung
Einige Beispiele aus der Rechtspraxis verdeutlichen die möglichen Konsequenzen:
Fall 1: Berlin-Zehlendorf (2019) Ein Grundstückseigentümer ließ ohne Genehmigung drei alte Eichen (Stammumfang jeweils über 100 cm) fällen, um eine bessere Bebaubarkeit zu erreichen.
- Bußgeld: 35.000 Euro
- Ersatzpflanzungen: 12 Eichen mit Stammumfang 18-20 cm
- Auflage: 5-jährige Pflegeverpflichtung mit jährlichen Kontrollberichten
- Folge: Verzögerung des Bauvorhabens um mehr als ein Jahr
Fall 2: München (2021) Eine Wohnungsbaugesellschaft entfernte ohne Genehmigung fünf Linden im Rahmen eines Bauprojekts.
- Bußgeld: 25.000 Euro
- Ausgleichszahlung: 15.000 Euro (da Ersatzpflanzungen vor Ort nicht möglich waren)
- Folge: Änderung der Bauplanung, um mehr Grünflächen zu schaffen
Fall 3: Hamburg (2020) Ein Privatmann fällte eine gesunde, 120 Jahre alte Buche, die ihm die Aussicht versperrte.
- Bußgeld: 10.000 Euro
- Ersatzpflanzung: Drei Buchen mit Stammumfang 20-25 cm
- Auflage: 10-jährige Pflegeverpflichtung
- Zusätzlich: Zivilrechtliche Klage der Nachbarn auf Schadenersatz
Verjährungsfristen und nachträgliche Entdeckung
Es ist wichtig zu wissen, dass Verstöße gegen Baumschutzbestimmungen auch Jahre später noch geahndet werden können:
- Die Verjährungsfrist für Ordnungswidrigkeiten beträgt in der Regel 3 Jahre
- Der Beginn der Verjährungsfrist ist nicht der Tag der Fällung, sondern der Tag, an dem die Behörde von der Fällung Kenntnis erlangt hat
- Durch Luftbildvergleiche, Hinweise von Nachbarn oder Kontrollen können illegale Fällungen auch Jahre später noch entdeckt werden
Selbst wenn du ein Grundstück kaufst, auf dem früher illegal Bäume gefällt wurden, kannst du unter Umständen als neuer Eigentümer zu Ersatzpflanzungen verpflichtet werden, auch wenn du selbst die Fällung nicht veranlasst hast.
Rechtmäßige Baumpflege ohne Genehmigung
Nicht jede Maßnahme an einem Baum erfordert eine Genehmigung. Es gibt eine Reihe von Pflegemaßnahmen, die du ohne behördliche Erlaubnis durchführen darfst – aber auch hier gibt es Grenzen.
Erlaubte Pflegemaßnahmen
Folgende Maßnahmen sind in der Regel ohne Genehmigung erlaubt:
1. Formschnitt: Der regelmäßige, fachgerechte Schnitt zur Erhaltung der Wuchsform (z.B. bei Hecken oder Formgehölzen) ist erlaubt. Wichtig ist, dass die Grundform des Baumes erhalten bleibt und nicht mehr als 20-30% der Blattmasse entfernt werden.
2. Auslichten der Krone: Das maßvolle Entfernen von Zweigen zur Reduzierung der Kronendichte ist erlaubt, solange die charakteristische Form der Krone erhalten bleibt und nicht mehr als 20% des Kronenvolumens entfernt werden.
3. Entfernen von Totholz: Das Entfernen abgestorbener oder absterbender Äste ist nicht nur erlaubt, sondern kann sogar im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht geboten sein. Allerdings solltest du beachten, dass ein gewisser Totholzanteil ökologisch wertvoll ist und, sofern keine Gefahr besteht, belassen werden sollte.
4. Jungbaumpflege: Erziehungsschnitte bei jungen Bäumen, um eine stabile Krone zu entwickeln, sind ebenfalls ohne Genehmigung möglich.
5. Notmaßnahmen: Bei akuter Gefahr (z.B. nach Sturm- oder Blitzschäden) darfst du auch ohne vorherige Genehmigung die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Gefahr abzuwenden. Dies muss jedoch der zuständigen Behörde nachträglich gemeldet werden, oft mit Fotodokumentation.